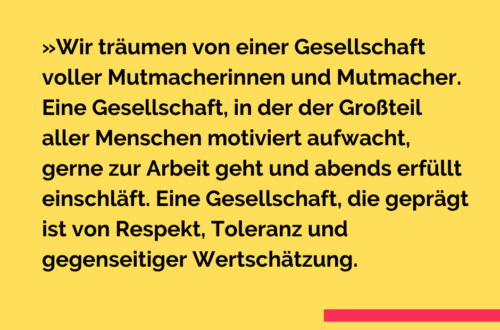-
Voller Neugierde
Hier ein kleiner Adventsgruß für euch! Stress und Neugierde können nicht gut miteinander. Wer voller Neugierde durch die Vorweihnachtszeit geht, muss sowieso entschleunigen und achtsamer werden. Bleibt also neugierig: Was wird der heutige Tag euch bringen? … Wenn ihr das Bild gerne als Postkarte kaufen möchtet, schreibt mir gerne.
-
“Der kommt wieder, der schafft’s eh nicht”.
Sieben Jahre lang war Alexander Abasov in einer Behindertenwerkstatt beschäftigt. Als er die Idee hatte, sich auf ein Praktikum in einer Werbeagentur zu bewerben, bekam er von den Verantwortlichen aus der Werkstatt nur „einen warmen Händedruck“. Er entschloss sich dann, eine Ausbildung als Mediengestalter zu beginnen und hatte sogar schon Kontakt zu einer Werbeagentur, die ihn ausbilden wollte. Wieder gab es keine Unterstützung seitens des Fachpersonals in der Werkstatt, nur den Kommentar: “Der kommt eh wieder, der schafft’s eh nicht”. Doch sein zukünftiger Chef glaubte an ihn und half ihm, sich durch den Behördendschungel zu kämpfen. Denn ein Mensch mit Behinderung, der eine Ausbildung zum Mediengestalter machen will, schien überhaupt…
-
Wer einmal in der Behindertenwerkstatt ist, kommt oft nicht mehr raus!
Inklusion darf kein Zufall sein, findet Anne Gersdorff, Referentin für Inklusion und Arbeit. Viele Menschen mit Behinderung würden bei einer Job-Beratung oft das nehmen, was ihnen von der Agentur für Arbeit serviert würde. Da sind dann oft Berufsbildungswerk oder Behindertenwerkstatt die einzigen Ratschläge. Doch leider sind diese Einrichtungen nicht wirklich inklusiv: Lauter Menschen mit Behinderungen lernen und arbeiten dort. Die ohne Behinderung sind Betreuende – ein klares Machtgefälle. Anne Gersdorff sitzt selbst im Rollstuhl und berät für das Projekt JOBinklusive andere Menschen mit Behinderungen, wie sie einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Das Kuriose: Oft scheitert es nicht an den Unternehmen, sondern an bürokratischen Hürden. Hier seht ihr das…
-
“Ich glaube, dass man oft aufgrund seiner Behinderung unterschätzt wird”
Noch immer haben Menschen mit Behinderungen schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt. Und dass, obwohl es in Deutschland schon viele Maßnahmen gibt, um Teilhabe im Job zu ermöglichen. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai habe ich mit dem Verein aussichtsreich e.V. ein Projekt gestartet. Wir fordern: Gleiche Chancen im Job! und haben eine Social-Media-Kampagne gestartet. Dazu habe ich mit drei spannenden Personen gesprochen und Interviews geführt. Im ersten Gespräch habe ich mit Zacharias Wittmann geredet, dem Gründer des Social Startups Companion2go. Warum es ganz praktisch sein kann, sich als Mensch mit Behinderung selbstständig zu machen und wie Menschen mit und ohne Behinderung am besten in…
-
Wie hilfreich ist Bildungsfernsehen, Maya Götz?
ARD und ZDF haben ihr Angebot für Schülerinnen und Schüler aufgrund des aktuellen Schul-Lockdowns erweitert. Vor zwei Wochen habe ich schon in einem Beitrag meine Sicht der Dinge dazu geschildert. Wie hilfreich sind die Angebote im Fernsehprogramm und in den Mediatheken wirklich? Das habe ich Maya Götz gefragt. Die Medienwissenschaftlerin ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk und hat mit mir ihre spannenden Einsichten in die Mediennutzung von Angeboten der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender geteilt. Für welche Kinder und Jugendliche ist das erweiterte Angebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender während des Lockdowns sinnvoll?Maya Götz: Im Prinzip ist es erstmal für alle sinnvoll. Vom linearen Angebot profitieren zum einen…