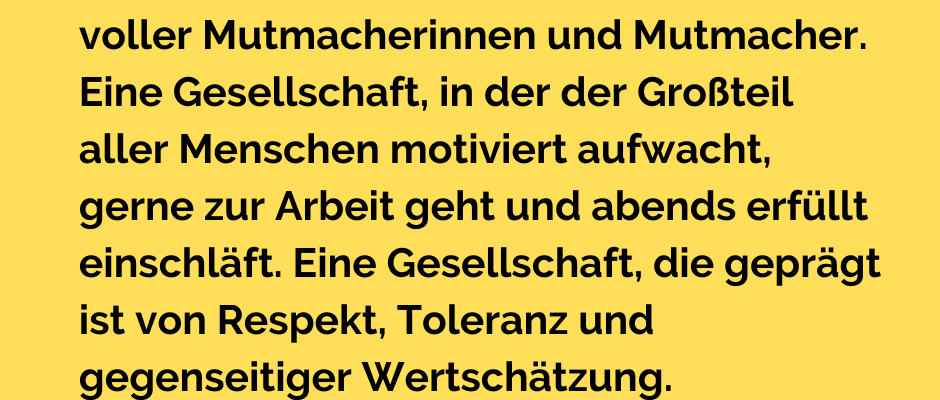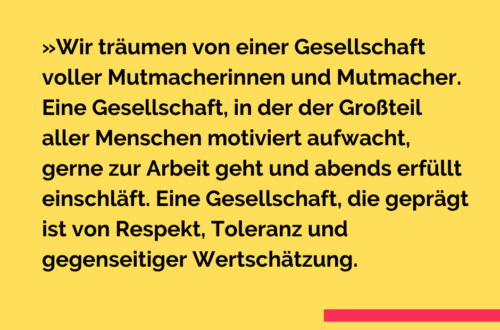-
Mut machen
Letztens habe ich Pascal Keller, Gründer des Start-Ups “Mein mutiger Weg” porträtiert. Wenn er Berufsorientierungs-Seminare für Schülerinnen und Schüler entwickelt, denkt er zuerst an seine eigene Schulzeit: “Was hätte ich mir damals gewünscht? Welche Fragen hatte ich?”
-
Kindern den Krieg erklären
In den letzten Wochen wurde ich vor die Herausforderung gestellt: Wie erkläre ich meiner großen Tochter (6 Jahre) den Krieg? Sie hat viele Fragen. „Wann hört der Streit wieder auf?“, fragt sie zum Beispiel regelmäßig. „Warum müssen Leute ins Gefängnis, wenn sie demonstrieren gehen?“ „Versteht Putin nicht, dass es doof ist, was er macht? Er sieht doch, wie viele Menschen aus der Ukraine fliehen.“ Alles Fragen, die ich manchmal mehr und manchmal weniger beantworten kann. Zum Glück gibt es gute Seiten im Internet, die Eltern Tipps geben, wie sie mit ihrem Kind über den Krieg reden können, zum Beispiel folgende: https://www.schau-hin.info/news/krieg-in-der-ukraine-kinder-mit-nachrichten-nicht-allein-lassen Auch für Kinder gibt es gute Seiten, je nach…
-
“Der kommt wieder, der schafft’s eh nicht”.
Sieben Jahre lang war Alexander Abasov in einer Behindertenwerkstatt beschäftigt. Als er die Idee hatte, sich auf ein Praktikum in einer Werbeagentur zu bewerben, bekam er von den Verantwortlichen aus der Werkstatt nur „einen warmen Händedruck“. Er entschloss sich dann, eine Ausbildung als Mediengestalter zu beginnen und hatte sogar schon Kontakt zu einer Werbeagentur, die ihn ausbilden wollte. Wieder gab es keine Unterstützung seitens des Fachpersonals in der Werkstatt, nur den Kommentar: “Der kommt eh wieder, der schafft’s eh nicht”. Doch sein zukünftiger Chef glaubte an ihn und half ihm, sich durch den Behördendschungel zu kämpfen. Denn ein Mensch mit Behinderung, der eine Ausbildung zum Mediengestalter machen will, schien überhaupt…
-
Wer einmal in der Behindertenwerkstatt ist, kommt oft nicht mehr raus!
Inklusion darf kein Zufall sein, findet Anne Gersdorff, Referentin für Inklusion und Arbeit. Viele Menschen mit Behinderung würden bei einer Job-Beratung oft das nehmen, was ihnen von der Agentur für Arbeit serviert würde. Da sind dann oft Berufsbildungswerk oder Behindertenwerkstatt die einzigen Ratschläge. Doch leider sind diese Einrichtungen nicht wirklich inklusiv: Lauter Menschen mit Behinderungen lernen und arbeiten dort. Die ohne Behinderung sind Betreuende – ein klares Machtgefälle. Anne Gersdorff sitzt selbst im Rollstuhl und berät für das Projekt JOBinklusive andere Menschen mit Behinderungen, wie sie einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Das Kuriose: Oft scheitert es nicht an den Unternehmen, sondern an bürokratischen Hürden. Hier seht ihr das…
-
“Ich glaube, dass man oft aufgrund seiner Behinderung unterschätzt wird”
Noch immer haben Menschen mit Behinderungen schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt. Und dass, obwohl es in Deutschland schon viele Maßnahmen gibt, um Teilhabe im Job zu ermöglichen. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai habe ich mit dem Verein aussichtsreich e.V. ein Projekt gestartet. Wir fordern: Gleiche Chancen im Job! und haben eine Social-Media-Kampagne gestartet. Dazu habe ich mit drei spannenden Personen gesprochen und Interviews geführt. Im ersten Gespräch habe ich mit Zacharias Wittmann geredet, dem Gründer des Social Startups Companion2go. Warum es ganz praktisch sein kann, sich als Mensch mit Behinderung selbstständig zu machen und wie Menschen mit und ohne Behinderung am besten in…